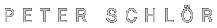Die Fremdheit von Licht und Schatten
Peter Schlörs Schwarzweiß-Fotografie zeigt Ansichten der Erde wie von einem anderen Planeten
von Christel Heybrock
Gleißendes Licht. Nachtschwarze Schatten. Ein Berg. Himmel. Bäume. Verlassene Behausungen. Fast kein Mensch zu sehen, manchmal: ein Schatten, der Fotograf. Der Mannheimer Peter Schlör, Jahrgang 1964, fühlte sich stets von den besonderen Möglichkeiten der Schwarzweiß-Fotografie angezogen; nach eigener Aussage entdeckte er als Zwanzigjähriger seine Liebe zu diesem Medium auf der Halbinsel Sinai. Ende 2009 stellte der Mannheimer Kunstverein Arbeiten der letzten Jahre (seit 2003) aus, begleitet von einer Buchpublikation, die von Schlörs Frankfurter Galerie Bernhard Knaus herausgegeben wurde: Der Fotoband „DEEP BLACK“ reicht zurück bis 1986 und stellt den ersten großen Überblick über Schlörs künstlerische Entwicklung dar. Schon beim ersten Hinsehen entwickeln seine Bilder eine Magie, der man sich kaum entziehen kann, und wenn die früheren Arbeiten den Betrachter zwar fasziniert, aber mit ungelösten Fragen zurück ließen, so ergibt sich mittlerweile ein großer, sinnvoller Zusammenhang.
Eine beklemmende und zugleich atemberaubende Stille geht von diesen Aufnahmen aus, in früheren Kulturepochen hätte man vielleicht von „Erhabenheit“ gesprochen – inzwischen ist uns dieser Begriff grundsätzlich etwas suspekt geworden. Aber etwas, was sich weit über den Menschen und seine Alltagsbelange erhebt, ein so unzugängliches Wort wie „Ewigkeit“ scheint ihnen inne zu wohnen. Das kündigte sich bereits in den achtziger Jahren bei Peter Schlör an. Wenn ein Mann an einer blockhaft strengen, bröseligen Hauswand vorbeigeht, die Tür wie ein schwarzes Loch da liegt und die Fensterländen darüber spitze Schatten auf die Mauer werfen, als hingen geschnittene Metallplatten dort herab – dann hat das nichts von einer lebendigen Momentaufnahme, sondern der Mensch scheint in einer rätselhaft bedrohlichen Welt dahin zu schlurfen, in einer Welt, die nicht für ihn gemacht ist und die er hinnehmen muss, weil es keine andere gibt. Es liegt bereits in dieser Aufnahme von 1986 „Venezianer” ein Untergrund von Existenzphilosophie.
Die verstörende Fremdheit des scheinbar Vertrauten hat sich bei Schlör seither noch viel unerbittlicher durchgesetzt. Mitunter sind seine Aufnahmen derart enigmatisch, dass der Betrachter sie kaum noch identifizieren kann. Was beispielsweise ist da im „Waldpark” passiert? Eine lange schwarze Bahn aus Nichts läuft spitzkegelhaft im Bildzentrum von der Unterkante aus nach oben und erstreckt sich über gut drei Viertel der Bildfläche, bevor sie an einem kahlen hellen Baumstamm endet. Zu beiden Seiten ist der Boden bedeckt von Laub, auf dem das Licht sich tausendfach bricht, einige ebenfalls kahle Bäume und Gestrüpp erheben sich in jener Zone, in der der schwarze Spitzkegel auf den weißen Stamm trifft. Kein Mensch, kein Tier weit und breit, drei Viertel des Bildes sind laubbedeckter Boden, der im Vordergrund in so plastischer Schärfe vor einem liegt, dass man einzelne Blätter botanisch identifizieren kann und man scheinbar nur den Fuß zu heben braucht, um selbst ins Bild hineinzugehen. Und der schwarze Kegel saugt einen auch förmlich hinein. Was ist er, wovor steht man da? Sollte es möglich sein, dass der weiße Stamm aus seiner Entfernung einen derart langen Schatten wirft? Der Schatten, dieses materielose Nichts, in dem sich die Erde aufzutun und ihre schwarze Tiefe zu zeigen scheint, er hat sich verselbständigt als Instanz des Unergründlichen, er ist es, der das Bild und das Sehen des Betrachters beherrscht.
Natürlich fragt man sich nicht zuletzt der Orientierung wegen, wie Schlör denn solche Aufnahmen gemacht hat? Dass da nicht nachträglich manipuliert und etwa in der Dunkelkammer oder am Computer ein derart dominierendes Bildelement hinein gemogelt wurde, das ist offensichtlich. Das Geheimnis von Schlörs Schatten liegt stets im Zeitpunkt der Aufnahme – Schatten sind nun mal am längsten und dunkelsten, wenn die Sonne tief steht. „Mein Lieblingslicht“, bekennt Schlör in dem erwähnten Buch, „ist das Auflicht. Das ist, wenn die Sonne direkt hinter mir steht. Ich fotografiere am liebsten bei tief stehender Sonne.“ Dann sind die Kontraste am schärfsten und die Formen bizarr. Aber ist das alles – sind Schlörs Aufnahmen nicht mehr als bizarre Hingucker?
Man muss sich klar machen, dass Schlörs Blick fast identisch ist mit der Position der Sonne und er die Welt sieht, wie sie sie sehen würde. Die tief stehende Sonne breitet zwangsläufig seine eigenen Ansichten vor ihm aus, sie breitet Bäume und Ufersäume, Wüsten, Berge und verlassene Behausungen vor ihm aus, aber auch den Blick auf ihn selbst: auf den eigenen Schatten, auf seine gelängte Silhouette, die mitunter an archaische Felszeichnungen erinnert und ihn zugleich als flüchtige, vom Verschwinden bedrohte Erscheinung kenntlich macht. Der Blick der Sonne – allein dieser Standort könnte die Ansichten der Erde wie Bilder von einem anderen Himmelskörper erscheinen lassen, aber bei Schlör kommt eine verwirrende Austauschbarkeit von Materie und Immaterialität hinzu. Wir sehen das, was fest, greifbar und existent ist: Häuser aus Ziegelsteinen, die geplatzte Rinde von sukkulenten Köcherbäumen, Sandhügel, Gestrüpp, den von Adern durchzogenen Steinkoloss eines Rantberges in Namibia. Doch es ist nicht die feste Materie, die den Blick fesselt, sondern die Fast-Greifbarkeit der Schatten und die blendende Energie des Lichts. In Schlörs Aufnahmen spielen die nichtmateriellen Phänomene eine dominante Rolle, sie sind es, die Macht über die Materie haben: Ob wir das Greifbare und Existente sehen, liegt im Ermessen des Lichts und der Schatten.
Der Mensch unterwirft also zwangsläufig sein Sehen, von einer Art Demut erfüllt, dem großen Naturgesetz der Physik. Bei Schlör hat dieser Aspekt nichts Starres, nichts Lebloses, die kosmische Dimension seiner Aufnahmen enthält vielmehr subtilste Veränderungen und Prozesse, die dem Betrachter ungewöhnliche Wahrnehmungsleistungen abfordern. Wenn wir als zivilisatorisch verblödete Technikfreaks die unglaublich nuancierten Wahrnehmungsfähigkeiten von Naturvölkern bewundern, müssen wir uns klar machen, dass diese Menschen ohne die Intelligenz der Sinne nicht Jahrtausende hätten überleben können. Schlör konfrontiert uns mit vergleichbaren Herausforderungen, die womöglich ebenso bedeutsam sind für das Überleben unserer Kultur. Was passiert da, wenn er die Schatten kahler Bäume am Mannheimer Neckar-Ufer fotografiert hat und manche Bäume zum Halbkreis verbogen erscheinen? Wenn er solche Ansichten seriell aneinander reiht und die gebogenen Schatten wie eine Wellenbewegung über die Bilder laufen?
Was den Betrachter bereits verwirrt, ist die Tatsache, dass man die schwarzen Bäume zunächst als Bäume und nicht als Schatten wahrnimmt, die von Bäumen am Rand einer Böschung auf eine tiefer liegende, besonnte Wiese geworfen werden. Schlör sorgte dafür, dass bei jeder Aufnahme ein Baumschatten fast im Bildzentrum stand, so dass die Schatten benachbarter Bäume perspektivisch gekrümmt erscheinen. Reiht man solche Bilder aneinander, kommt diese vertrackte Wellenbewegung zustande. Weitere Herausforderung: Was zunächst als bloße Wiederholung der immer gleichen Aufnahme erscheint, entpuppt sich bei genauer Detailwahrnehmung als Fortschreiten – niemals ist derselbe Baumschatten zweimal zu sehen! Schlör machte seine Aufnahmen an der Uferböschung in ganz bestimmten Abständen, er schritt die Baumreihe ab und nimmt den Betrachter nun dabei mit. Das nächste Mal bei einer vergleichbaren Situation in der Wirklichkeit wird jeder, der Schlörs Aufnahmen gesehen hat, über seine eigene Wahrnehmung von Wirklichkeit neu nachdenken.
In der Stille und Intensität, die von diesen Bildern ausgehen, wird man gezwungen, feinste Details zu beobachten, während man sich zugleich von der Weite, von der potentiellen Endlosigkeit der Ansichten zutiefst berührt fühlt. Erneut am Mannheimer Neckarufer fotografierte Schlör 2003 eine Serie beim Winterhochwasser. Wieder sind es schwarze Baumstämme, die in scheinbarer Wiederholung eine potentiell unendliche Reihe bilden. Aber hier sind es nicht ihre Schatten, sondern die Bäume selbst, gesehen im Gegenlicht eines trüben Wintertages und von der fernen Horizontlinie getrennt durch ein silbergraues Gewässer, das die Helligkeit des Himmels reflektiert: den breit angeschwollenen Neckar. Die Horizontlinie aber hat es in sich: Auch dort in der Ferne erstreckt sich eine scheinbar unendliche Uferlinie mit kahlen Bäumen und Gesträuch, so dass der Blick des Betrachters zwischen zwei Waagrechten wechselt – der schwarzen, von den massigen senkrechten Baumstämmen geprägten Linie im Vordergrund und der feinen, silbrig filigranen Linie in der Ferne.
Das allein wäre wahrlich keine Herausforderung für die Fähigkeit des Sehens. Aber! Schlör setzte die Vordergrundlinie sozusagen auf eine Ebene mit der Blickperspektive eines möglichen Spaziergängers, der zwischen kahlen Bäumen hindurch aufs andere Ufer schaut. Man sieht die Bodenebene mit Grasbewuchs, und würde man ein wenig weiter nach unten schauen, müsste man die eigenen Füße sehen, indes die Kronen der Bäume nicht sichtbar sind, sondern von der oberen Bildkante angeschnitten wurden. Ist es aber nicht immer derselbe Baum, der sich hier 15 Mal wiederholt? Das kann nur ein Betrachter vermuten, der Bäume noch nie bewusst wahrgenommen hat – die Dicke, der Wuchs der Stämme sind nirgends identisch, und anhand des feinen Gewebes der herabhängenden unteren Äste und Zweige erkennt man fasziniert, dass jeder Baum ein Individuum ist, dass ihre Wachstumsmuster einander zwar ähneln, aber sich nicht wiederholen. Und dann die Uferlinie in der Ferne: da liegt beispielsweise eine zarte Dreiergruppe von Bäumen, an der man sich orientieren kann. Beim ersten Bild ist sie ein ganzes Stück rechts neben dem Vordergrundbaum zu sehen. Beim zweiten Bild ist sie kaum merklich nach links gerückt … bis sie schließlich hinter einem der Stämme verschwindet und anderen Gruppierungen an der fernen Uferlinie Platz macht, die sich ihrerseits so unaufdringlich verschieben, dass man es kaum merkt.
Wirklichkeit – sie ist für Menschen nicht zu erfassen. Indem der Mensch sich bewegt, kann er stets nur winzige Ausschnitte wahrnehmen, während der große, unendliche Zusammenhang ihm zwar erahnbar bleibt und ihm Herz und Sinne weitet, aber sich ihm niemals erschließt. Und selbst die Ausschnitte, die er wahrnimmt, bleiben stumm und stets sie selbst, sie öffnen sich ihm nicht. Er nimmt sie wahr, aber er versteht sie nicht.
Schlör hat mit Vorliebe Aufnahmen im Winter gemacht, aber von überwältigender Präsenz sind vor allem seine Bilder aus der afrikanischen Namib-Wüste, aus Italien, Spanien und dem Nahen Osten. Auf einer Ansicht des Timanfaya – Nationalparks auf der Vulkaninsel Lanzarote bewegt sich der Schatten eines Menschen (des Fotografen) über die archaische Ewigkeit einer leblosen Sand- und Gerölllandschaft, als sei er auf einen fremden Planeten verschlagen worden. Unfertig verlassene Häuser auf der Halbinsel Sinai: architektonische Gerüste, die sich in grellem Licht der Schwärze der Schatten widersetzen, die sie selber auf den Sand werfen und die aus ihren Öffnungen hervordringen. Auf einem anderen Bildpaar: der Schatten eines Turms, den man selber nicht sieht, schneidet sich als finsteres Dreieck in eine spärlich bewachsene Sandebene ein, einmal von links hin zur Mitte, ein anderes Mal von rechts zur Mitte, eine unerklärliche, wandernde Bedrohung. Schlör fotografierte eine in der Gischt sich versprühende „Bugwelle”, er fotografierte leuchtende Wolken am Himmel „Chimague” und das verfallende arabisch-normannische Kastell des (eigentlich sehr lebendigen) italienischen Städtchens Mistretta, auch dies ein Anblick wie aus einer fremden Welt.
Und gibt es etwas Lautloseres, Gespenstischeres als die Serie der “„Versandungen“:/portfolio/sanding+up.html (2004) am Rand der Namib-Wüste? Schlör blickte in verlassene Häuser, durch eine Zimmerflucht, an Türlaibungen vorbei und auf einen schmalen Zierfries an der Wand. Betreten konnte er die Innenräume kaum noch: Die Wüste ist dabei, sich den Lebensraum der Menschen zurück zu holen, meterhoch ist der Sand hinein geweht, bald werden die Dünen alles verschluckt haben. Vielleicht täuschen wir uns, wenn wir glauben, die Erde sei ein Ort für Menschen. Da, wo Menschen nicht sind, erweist sie ihre Schönheit. Die der Sandwellen, der Bergadern und der schwarzen Himmel, und die weißen Berge von „Lefka Ori” auf Kreta erheben sich mit einer Geste, die der Bewegung von Meereswogen gleich ist.
Christel Heybrock für “Kunst und Kosmos” | April 2010